Aktuelle Themen:
MDR
Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte
MPDG
Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz 2022
Straf- und Bußgeldvorschriften
Usability & IEC 62366-1
Die Gebrauchstauglichkeiten von Medizinprodukte
EN ISO 14971
Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
User Centered Design
Mit UCD zu untauglichen Medizinprodukten
Arbeitsgruppen
Webinare
Ziele
- Verbesserte Vigilanzberichterstattung
- Bildung des Kompetenzzentrums
Members area
Arbeitsgruppe: Peer Review und Definition von Sicherheits- und Innovationszielen
Zu oft falscher Fokus bei Medizinprodukten: Sie müssen am Dentalmarkt erfolgreich sein, nicht am Patienten!
Ein Beispiel: Wir sehen das tagtäglich bei den PKWs. Statt kleine leichte effiziente Autos mit angepassten Reifen zu bauen, präsentieren die Herstellern immer größere Spritschlucker-SUVs mit völlig über-dimensionierten breiten Rädern, die in dieser Größe keinerlei Nutzen bieten.
Bei Medizinprodukten ist es nicht anders: Es wird das angeboten, was der Markt will. Nicht das, was für die PatientInnen vernünftig ist.
2500 vorzeitige Todesfälle wegen Mikroplastik nur durch die Anfertigung einer ‚Digitalen Vollprothese‘!
Jedes Jahr sterben in der Europäischen Union Hunderttausende Menschen vorzeitig – wegen der Belastung der Luft durch Feinstaub und andere Schadstoffe. Im Jahr 2019 kamen so schätzungsweise 307.000 Menschen in der EU ums Leben. Das gab die Europäische Umweltagentur EEA bekannt.
Von der Sinnhaftigkeit einer Einweganprobe-Prothese aus weißem Kunststoff abgesehen, entsteht beim Ausfräsen einer Digitalen Vollprothese ca. 3000x mal mehr Mikroplastik als gegenüber einer konventionellen Prothese aus Spritzgusskunststoff. Aus unserer Umwelt sind die Unmengen an Mikroplastik praktisch nicht mehr abbaubar und gefährden über die Nahrungskette gleich mehrere Generationen von Mensch und Tier. Nicht auszudenken, welche Auswirkungen es hat, wenn nur noch millionenfach ‚Digitale Vollprothesen‘ hergestellt werden.
Aber der Trend ‚Digital ist die Zukunft‘ scheint immer noch am Markt anzukommen. Damit keine Zweifel aufkommen, werden sogar wissenschaftliche Studien so manipuliert, dass sie wirksam für den Absatz minderwertiger Medizinprodukte genutzt werden können. Deshalb sind immer Experten und Expertinnen der zuständigen Fachgremien gefordert, die Wissenschaftlichkeit von Studien vor der Veröffentlichung sorgfältig zu prüfen und bei Bedarf zurückzuweisen.
Dass dies nicht immer so funktioniert, wie wir Zahnärzte und Zahnärztinnen es für wünschenswert halten und dass doch unwissenschaftliche Thesen für wahre Tatsachen vorgestellt werden, liegt an der mangelnden Kenntnis der Zahnmediziner über Regulatory Sciences.
Mit Regulatory Science wirksam Fake Science begegnen!
Es wird von Seiten der Dentalindustrie stets gezielt versucht, die medizinische Wissenschaft für eigene Zwecke zu sabotieren, ohne dass wir es merken (sollen). Fake-Science ist das neue brisante Thema. Denn es ist längst bekannt geworden, dass besonders in der Medizin im größeren Stil umstrittene Mittel gegen Krebs, Autismus und Parkinson von dubiosen Firmen mit ungeprüften Studien, die teilweise sogar in renommierten Fachjournalen zitiert werden und als überaus wirksam beworben und verkauft wurden. Mit fatalen und sogar tödlichen Folgen. Aber auch große deutsche Pharmafirmen bedienen sich öfter scheinwissenschaftlicher Verlage, um dort Studien zu veröffentlichen, die von seriösen Fachjournalen möglicherweise nicht veröffentlicht würden.
Die Zahnmedizin ist nicht ausgenommen!
Das Peer Review hat auch bei uns Zahnmedizinern derart versagt, dass unwissenschaftliche Thesen sogar von renommierten Fachblättern publiziert und sogar von Fachgesellschaften gestützt werden.
Die Hersteller freuen sich, dass die Zahnmediziner immer noch nicht hinter die Machenschaften der gesamten internationalen Dentalindustrie gekommen sind.
So hat dieses Geschäftsgebaren dramatische Folgen:
Die Folgen sind absolut katastrophal und die Ausmaße sind unglaublich. Denn fast alle Zahnmediziner nehmen Aussagen aus Fake-Science-Studien für bare Münze. Sie können sich nicht vorstellen, dass die Dentalindustrie ihre Medizinprodukte auf Erfolgswahrscheinlichkeit am Markt und nicht am Patientennutzen entwickelt.
Wir müssen in Zukunft genau auf den klinischen Nutzen bei Medizinprodukten auch in wissenschaftlichen Studien schauen. Sind sie klinische valide, glaubwürdig, wissenschaftlich fundiert, dann können wir gemeinsam die ein fortschrittliche Zukunft ohne Fake-Science blicken.
Doch oft glauben wir nur an das, was gerne als Zahnmediziner wünschen, nicht das, was wirklich wahr ist. Warum ist das so?
Fehlentwicklung: Die fatale Verwechslung Customer Requests mit Customer Requirements!
Customer Requests
Ein Customer Request ist erst mal nichts weiter als ein Wunsch — von dem der Kunde natürlich behauptet, ihn zu brauchen. Meist werden Customer Requests im Sinn einer Lösungsskizze d.h. Blackbox-Bescheibung des Systems formuliert. Zum Beispiel „können Sie die Tabelle nicht so machen, dass ich sie durch Klicken auf die Spaltenköpfe sortieren kann“ (z.B. nach Behandlungsdatum) oder „können Sie den Button XY hinzufügen/verschieben“. Damit sind die Customer Requests auf der Ebene der Systemanforderungen/-Spezifikationen einzusortieren.
Customer Requirements
Hinter diesen Customer Requests verbergen sich oft nicht explizit bewusste Customer Requirements, genauer gesagt „User Requirements“ auf deutsch Nutzungsanforderungen. Nutzungsanforderungen zählen zu den Stakeholder-Anforderungen und sind definiert als „an einem interaktiven System notwendige Tätigkeit in einer die Tätigkeit beschreibenden Weise, nicht in technisch realisierter.“
Eine Nutzungsanforderungen könnte lauten (passend zu obigem Customer Request): „Der Nutzer muss am System die Patienten, die zuletzt behandelt wurden erkennen können“. Als Verb stehen nur „eingeben“, „auswählen“ oder kognitive Leistungen wie hier „erkennen“ zur Auswahl.
Vom Customer Request zum Customer Requirement
Customer Requirements sollte man systematisch herleiten. Dazu gibt es Verfahren. Das direkte Befragen der Nutzer nach Wünschen ist nicht zielführend wie Henry Ford schon wusste:
„Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie brauchen, hätten sie gesagt ‚schnellere Pferde’“.
Oder um es mit Steve Jobs zu sagen: Es ist nicht die Aufgabe der Kunden zu wissen, was sie wollen. Das hört sich arrogant an, stimmt aber. Es ist Aufgabe des Produktmanagements aus einem Kontext die Nutzungsanforderungen (user requirements) abzuleiten. Die Kundenwünsche sollten meist nur der Anlass sein, die wirklichen Anforderungen zu erheben.
Wer das nicht versteht, wird auch nicht verstehen, weshalb 45% der implementierten Funktionalitäten überhaupt nicht benötigt werden. Hier wurden requests mit requirements verwechselt. Eine teure Angelegenheit.

Foto: Vita Zahnfabrik
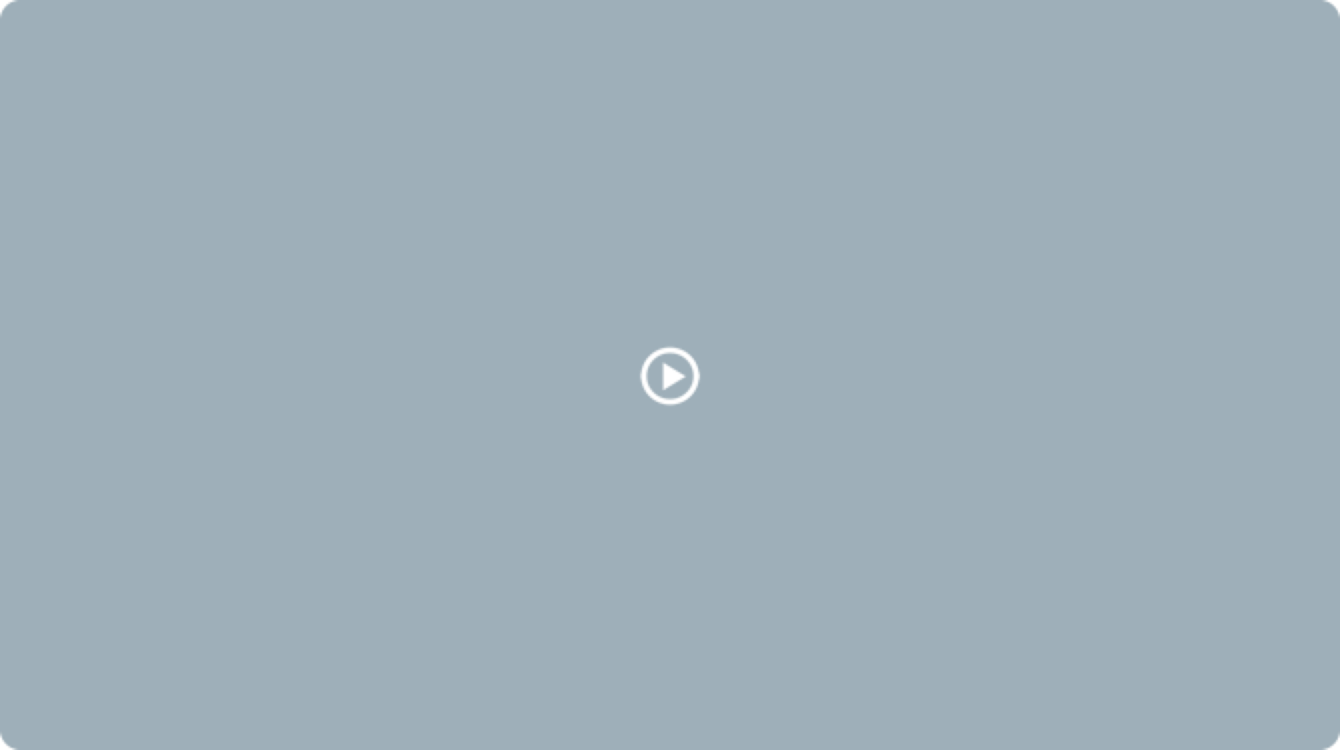
Kein Video zu sehen? Cookies neu setzen
Prof. Dr. Christian Johner spricht über user requests mit user requirements und die IEC 63266
Nutzer sind Experten für den Nutzungskontext. Aber in ihrer Rolle als Nutzer sind sie weder Requirements-Engineers noch Interaktionsdesigner noch Usability-Experten. Sie verfügen nicht über deren Kompetenzen und beherrschen nicht den Prozess einer normenkonformen, „gebrauchstauglichkeitsorientierten Entwicklung“, wie das die IEC 62366-1 nennt.
Genau diese Fähigkeiten und Kompetenzen müssen die Hersteller aber bestimmen und nachweisen, und zwar bei der Entwicklung jedes Produkts erneut!
Wenn die Hersteller die Nutzer bei der Entwicklung ihrer Produkte mit einbeziehen, sollten sie sie im Rahmen von Kontextinterviews befragen. Sie dürfen sie aber keine Spezifikationen mitbestimmen lassen und sollten deren Rolle in diesem Bereich beschränken.
Weitere Informationen zum User Centered Design, den Fehlentwicklungen bei Medizinprodukten und den vielen manipulativen in Fachzeitschriften veröffentlichten Fake-Studien erfahren Sie in den Webinaren. Welche Webinare wann stattfinden erfahren Sie hier.
Interimsvorstand der DGMPS Dr. Axel Scheffer, Am Wasserturm 1, D-40668 Meerbusch,
Tel.: 0162 9695123, vorstand@dgmps.de Impressum
Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.
Verweigern
OK